Literatur
Literatur: Sprachkunst, Vernetzung zwischen Kommunikatoren und ästhetischer Spiegel
Perspektiven einer vergleichenden Literaturwissenschaft
Die gegenwärtige Mainstream-Literaturwissenschaft ist, ebenso wie die buchgestützte Literatur selbst, genetisch, funktional und strukturell an eine Gesellschaft gebunden, deren radikalen Wandel wir augenblicklich erleben. Sie steht vor der Aufgabe, ihre Position in einer pluralistischen Gesellschaft, die sich als multimedial und multisensuell begreift, neu zu definieren. Der kaum mehr überhörbare Ruf nach Interaktivität und Multimedialität drückt das Bedürfnis der Menschen aus, dem Zusammenwirken der Kommunikationspartner und Sinne mehr Bedeutung zu geben, als dies in der Buchkultur der Fall war, die autonome Kunstwerke und die Verschriftlichung von Informationen einseitig prämierte. Die Aufgaben einer zeitgemäßen vergleichenden Literaturwissenschaft erweitern sich deshalb. Sie kann sich nicht mehr nur auf Relationen zwischen Texten konzentrieren, sondern muss auch das ökologische Zusammenwirken von Literatur mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen sowie die Auswirkungen des medialen Wandels auf den Literaturbegriff erforschen.
Die an eine hochgradig normierte Schriftsprache, an Papier, Buchdruck und Markt gebundene 'Literatur' erscheint als Sonderfall der Sprachkunst, die sich vieler Medien und kommunikativer Netze bedienen kann. In vielen Kulturen nutzte und nutzt sie ausschließlich die mündliche Rede. Oft bleibt diese an geographische Räume, bestimmte Personen, Handlungsformen und vor allem an unmittelbare Interaktion gebunden. Unter den Bedingungen solcher deiktischer, zeigender Sprachverwendung kann das Ideal 'autonomer Sprachkunstwerke' nicht entstehen. Wohl aber ließen sich, vor allem durch Institutionalisierung von Aufführungssituationen und mit hochartifiziellen Abstimmungen zahlreicher Ausdrucksmedien komplexe Gesamtkunstwerke wie Oper, Tanztheater, Schauspiel sowie in jüngster Zeit Performances erzeugen. Eine klare Trennung zwischen Zuschauern und die Professionalisierung der Akteure war (und ist) allerdings eine Voraussetzung für diese Formen der Medienintegration. Gegenwärtig formieren sich neue Räume, in denen Rede, Schrift und andere Medien zusammenwirken.
Zum Verständnis dieser modernen Kunstformen dürfte die vergleichende Untersuchung von sprachlichen Ausdrucksformen in Kulturen, in denen der Schriftgebrauch noch nicht ausgeprägt und prämiert ist, mindestens genauso aufschlußreich sein wie der Blick auf die Experimente der westlichen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, die durch Ausbruchsversuche aus der medialen Gebundenheit der Literatur an das Buch geprägt sind. Ihre Paradigmen werden heute von der Netzkunst aufgegriffen und gemäß der Materialität des Mediums Internet umdefiniert und re-formiert. Literatur als Medium der Vernetzung zwischen Autoren und Rezipienten zu verstehen, ist eine spezifische Leistung einer kommunikationswissenschaftlichen Literaturbetrachtung.
entwickelten sich immer in Abgrenzung zu den interaktionsarmen und monomedialen Paradigmen der Buchliteratur, allerdings als nicht-prämierte Randerscheinung. Es scheint, daß erst jetzt, wo die ‚digitalen‘ Medien und Netzwerke viele Arbeitsformen verändern, auch die literarische Produktion ihre neuzeitlichen Grenzen überschreiten kann.
Eine Gesellschaft, die die Bedeutung der rückkopplungsarmen Massenmedien - zu denen auch die Belletristik zählt - zugunsten interaktionsintensiver technisierter und leiblicher Medien verschiebt, braucht ökologische und dialogische ästhetische Visionen, die zum ästhetischen Design multimedialer Räume beitragen. Eine zeitgemäße Literaturwissenschaft wird sich deshalb nicht auf Text und Schrift beschränken können. Eine vergleichende Literaturwissenschaft kann bei der Entwicklung eines multimedialen und interaktiven Literaturverständnisses eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn sie nicht mehr nur gedruckte Texte verschiedener Zeiten und Kulturen, sondern das Zusammenwirken der verschiedenen Ausdrucksmedien und Kommunikatoren miteinander vergleicht. Für diese Aufgabe bietet sich ein mehrdimensionales, triadisches kommunikationstheoretisches Modell an.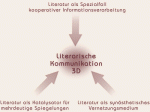
Vor dem Hintergrund des triadischen Modells läßt sich Literatur als Spiegel nicht nur der Autoren sondern auch vieler anderer Medien: Gesellschaften, andere Kunstgattungen, Natur usf. verstehen. Jede Kultur prämiert bestimmte Formen der Spiegelung und damit eröffnet sich für die vergleichende Lizteraturwissenschaft ein klares Untersuchungsraster.
Ästhetische Spiegelungen im interkulturellen Vergleich